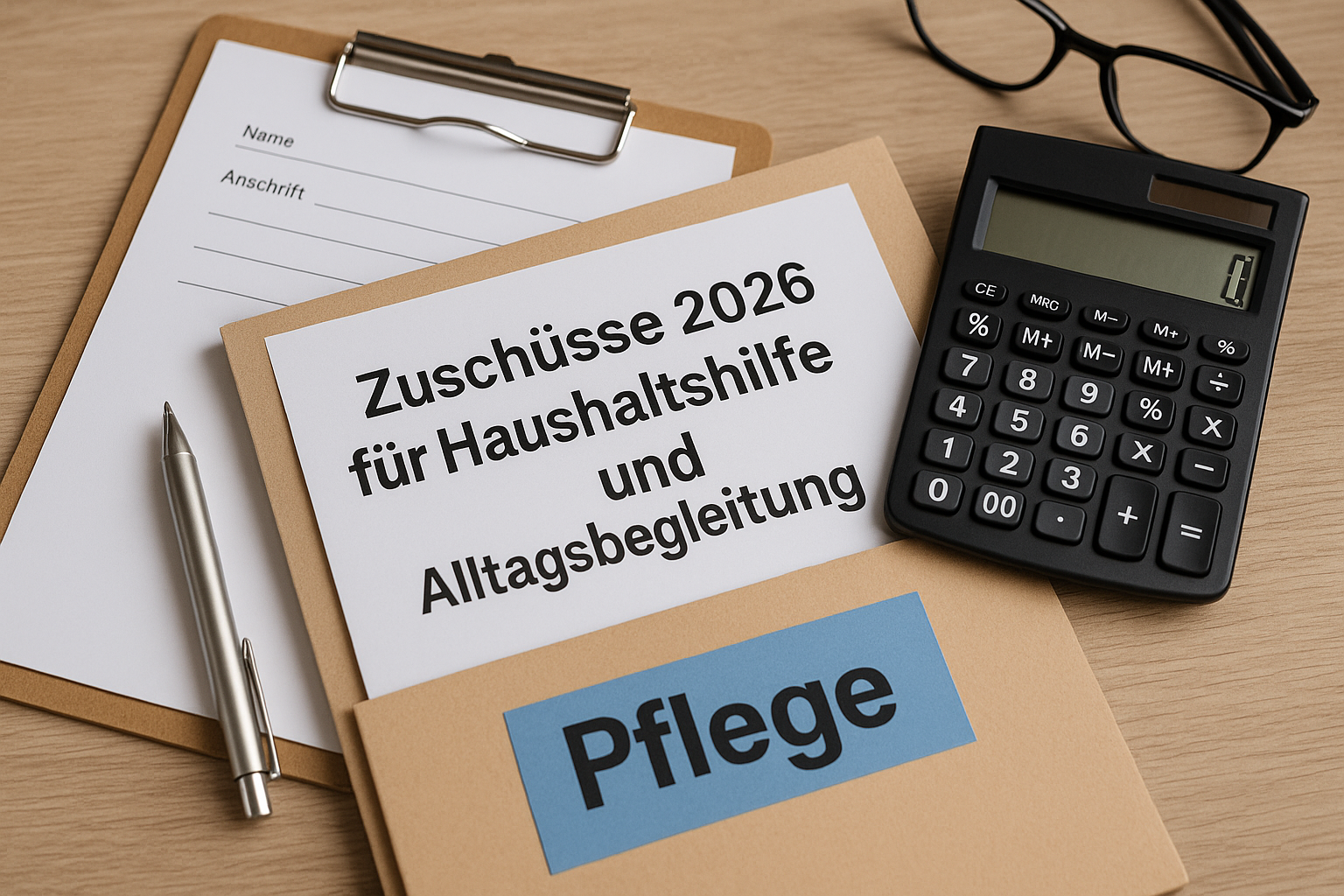Wer den Alltag zu Hause kaum noch allein bewältigen kann, hat oft Anspruch auf finanzielle Unterstützung. Ob durch eine Haushaltshilfe, eine Alltagsbegleitung oder eine Betreuungskraft – der Staat fördert diese Hilfen, wenn sie die Selbstständigkeit erhalten oder Angehörige entlasten. Im Jahr 2026 treten dabei einige Anpassungen in Kraft, die für viele Familien, Senioren und Pflegebedürftige im Landkreis Böblingen, Tübingen und Calw besonders interessant sind.
Welche Zuschüsse gibt es 2026 für Haushaltshilfe und Alltagsbegleitung?
Für das Jahr 2026 bleiben die bekannten Fördermodelle bestehen – sie werden aber teilweise angepasst. Entscheidend ist, ob ein Pflegegrad vorliegt oder die Unterstützung aus anderen Gründen medizinisch notwendig ist. Die wichtigsten Zuschüsse im Überblick:
- Entlastungsbetrag (§ 45b SGB XI): 131 € monatlich für alle mit Pflegegrad 1–5. Kann für Haushaltshilfen, Alltagsbegleitung oder Betreuung genutzt werden.
- Pflegesachleistungen (§ 36 SGB XI): Zuschüsse für Dienstleistungen durch zugelassene Pflegedienste – zum Beispiel für hauswirtschaftliche Unterstützung.
- Haushaltshilfe über die Krankenkasse (§ 38 SGB V): Wenn Krankheit, Schwangerschaft oder Krankenhausaufenthalt die Haushaltsführung verhindern.
- Steuerliche Absetzbarkeit: Bis zu 20 % der Kosten (max. 4.000 € p. a.) können als haushaltsnahe Dienstleistungen steuerlich geltend gemacht werden.
Der Entlastungsbetrag 2026 – kleine Hilfe mit großer Wirkung
Der Entlastungsbetrag ist die bekannteste Förderung für Unterstützung im Alltag. Pflegebedürftige mit anerkanntem Pflegegrad 1–5 erhalten monatlich 131 €, die zweckgebunden für zertifizierte Angebote eingesetzt werden können. Dazu gehören:
- Haushaltshilfen für Reinigung, Wäsche und Einkauf
- Alltagsbegleitung für Spaziergänge oder Arzttermine
- Betreuung zu Hause zur Entlastung der Angehörigen
Der Betrag wird nicht bar ausgezahlt, sondern über die Pflegekasse abgerechnet. Nicht genutzte Beträge können bis zum 30. Juni 2027 übertragen werden – so entsteht ein Jahresguthaben von bis zu 1.572 €.
Zuschüsse der Krankenkasse – Hilfe bei Krankheit, Schwangerschaft oder Überlastung
Auch ohne Pflegegrad können Krankenkassen die Kosten für eine Haushaltshilfe übernehmen, wenn eine medizinische Notwendigkeit besteht. Typische Fälle:
- Nach einem Krankenhausaufenthalt oder einer Operation
- Während einer Risikoschwangerschaft oder im Wochenbett
- Bei akuter Erkrankung oder körperlicher Einschränkung
- Wenn Eltern ihre Kinder vorübergehend nicht versorgen können
In solchen Fällen kann die Krankenkasse eine Haushaltshilfe nach § 38 SGB V bewilligen – meist für bis zu vier Wochen (in Ausnahmefällen länger). Wichtig ist eine ärztliche Bescheinigung über die Notwendigkeit und die vorherige Abstimmung mit der Kasse.
Pflegesachleistungen und Kombinationsmodelle
Wer bereits einen Pflegegrad hat, kann statt des Entlastungsbetrags auch Pflegesachleistungen in Anspruch nehmen. Diese werden direkt an den Pflegedienst gezahlt, etwa für Hilfe beim Einkaufen, Putzen oder der Körperpflege. Alternativ kann ein Teil als Pflegegeld ausgezahlt und der Rest für Dienstleistungen genutzt werden – das nennt sich Kombinationsleistung.
Ab 2026 sollen die Beträge für Sachleistungen erneut um etwa 4,5 % steigen. Das bedeutet: mehr Budget für Entlastung im Alltag und weniger Eigenanteil für Pflegebedürftige.
Steuerliche Vorteile nutzen
Private Ausgaben für haushaltsnahe Dienstleistungen sind steuerlich absetzbar. Das gilt auch, wenn Sie keine Zuschüsse der Pflegekasse erhalten. Anerkannt werden zum Beispiel:
20 % der Ausgaben, maximal 4.000 € pro Jahr, können direkt von der Steuerlast abgezogen werden (§ 35a EStG). Wichtig: Die Zahlung muss unbar erfolgen (Überweisung oder Lastschrift) – Barzahlungen erkennt das Finanzamt nicht an.
Förderung in den Landkreisen Böblingen, Tübingen und Calw
Zusätzlich zu bundesweiten Leistungen fördern viele Landkreise in Baden-Württemberg regionale Projekte oder Nachbarschaftshilfen. In Böblingen, Tübingen und Calw gibt es mehrere anerkannte Anbieter wie FamiliaPlus, die zertifizierte Leistungen nach § 45b SGB XI anbieten. So werden die Zuschüsse direkt verrechnet – ohne komplizierte Antragstellung.
FamiliaPlus unterstützt Sie bei der Antragsstellung, prüft die Abrechnungswege mit der Pflege- oder Krankenkasse und hilft beim optimalen Einsatz Ihrer Ansprüche – von der Haushaltshilfe über den Entlastungsbetrag bis hin zu regionalen Zusatzleistungen.
Fazit: Zuschüsse 2026 clever kombinieren
Wer die Möglichkeiten kennt, kann viele Kosten vermeiden. Zuschüsse der Pflege- und Krankenkassen, steuerliche Vorteile und regionale Förderungen lassen sich miteinander kombinieren. Besonders für Familien und pflegende Angehörige lohnt es sich, den Überblick zu behalten – denn schon kleine Beträge können im Alltag große Entlastung bringen.
FamiliaPlus informiert Sie regelmäßig über aktuelle Förderungen und hilft bei der praktischen Umsetzung – persönlich, regional und zuverlässig im Landkreis Böblingen, Tübingen und Calw.